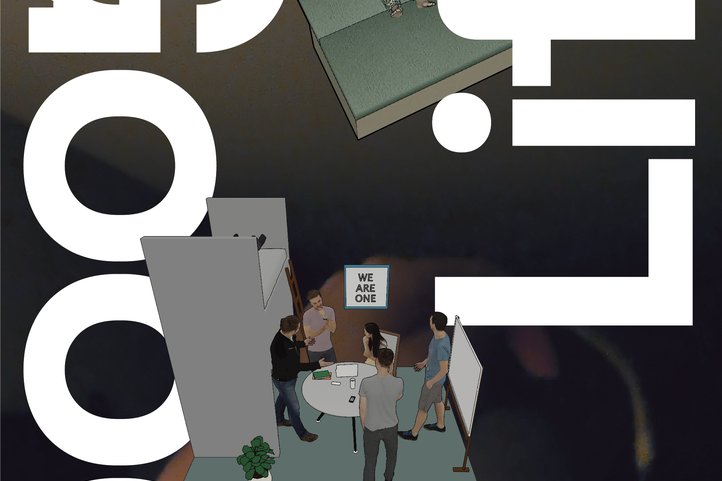Kunst und Design
Florian Wüst
Allgemeine Wissenschaften
- Studiengang Integriertes Design
- E-Mail fwuest@hfk-bremen.de
Aktuelle Kurse
Alle öffnen
- Einstellung zum Selbst (Block A) Einstellung zum Selbst 15. Oktober – 28. November 2025 Florian Wüst in Zusammenarbeit mit Daniel Neubacher (Videowerkstatt) „Die Einstellung ist die Einstellung. Die Einstellung von etwas und die Einstellung zu etwas.“ (Gertrud Koch) Die Einstellung ist ein kontinuierlich belichtetes, auf Video oder digital aufgezeichnetes, ungeschnittenes Stück Film. Bis die Kamera „rollt“, erfolgen zur Einrichtung der Einstellung unzählige Entscheidungen: ein Standpunkt wird bestimmt, eine Optik gewählt, Licht gesetzt, Akteur:innen platziert usw.. Spiel- und Dokumentarfilm unterscheiden sich hier nicht grundsätzlich. Die Konstruiertheit der dokumentierten Realität ist selbst der Aufnahme einer verwackelten Handykamera eingeschrieben. Die Frage nach der Wahrheit der Bilder ist längst irrelevant, wie Hito Steyerl in „Die Farbe der Wahrheit. Dokumentarismen im Kunstfeld“ (2008) in Bezug auf von CNN ausgestrahlte Bilder eines Korrespondenten im Irakkrieg darlegt, auf denen kaum etwas zu sehen ist: „Sie repräsentieren nichts, zumindest nichts Erkennbares mehr. Ihre Wahrheit liegt jedoch in ihrem Ausdruck. Sie sind lebhafter und akkurater Ausdruck jener Ungewissheit, die nicht nur die zeitgenössische dokumentarische Produktion beherrscht, sondern die Welt der Gegenwart schlechthin.“ Das verwackelte oder unscharfe Bild ist seit jeher Methode eines subjektiven Blicks, der sich über technische Unzulänglichkeit artikuliert und dem das Ungewisse zuspielt: Hier spricht das Ich der Filmemacher:in ohne Gewähr. Wenn das Dargestellte und die Darstellung ein Verhältnis eingehen, das die Gegebenheiten der Produktion nicht kaschiert, sondern offenlegt, geradezu ausstellt, übernimmt die Filmemacher:in sichtbar Verantwortung, macht sich angreifbar, umso mehr beim Tritt vor die Kamera und ans Mikrofon, dort, wo es kein Versteck hinter der vermeintlichen Objektivität eines dokumentarischen Bildes, einer neutralen Sprecher:innenstimme oder einer fiktiven Handlung gibt. Auch in diesem Sinne bildet die „Einstellung zu etwas“ den Kern der autobiografischen und autofiktionalen Erzählung im Film. Das Gestalterische Projekt mit Theorieanteil „Einstellung zum Selbst“ will dazu anleiten, dezidiert subjektive, autobiografische oder autofiktionale Ansätze zu entwickeln und mit Mitteln des Films umzusetzen – von performativer Selbstinszenierung, Reenactment, Alltagsdokumentation, Filmtagebuch und -essay bis zu Found Footage. Involviertheit, affektive Zeugenschaft oder auch die Beziehung von indviduellem und kollektivem Erinnern sollen im Vordergrund der Auseinandersetzung mit Themen stehen, denen eine persönlich empfundene Dringlichkeit unterliegt, seien es die neuen autoritären Tendenzen und Sprachverbote in der Gesellschaft oder die blinden Flecken der eigenen Familiengeschichte. Der siebenwöchige Kurs umfasst sowohl Praxisübungen als auch Theorieeinheiten in Form diskursiver Inputs und gemeinsamer Sichtungen von Filmen u.a. von Alex Gerbaulet, Maria Mayland, Valérie Mrejen und Silke Schönfeld. Diese unterstützen die Erlangung künstlerischer Entscheidungskompetenzen im komplexen Arbeitsbereich des bewegten Bildes. Einführungen in Schnittprogramme, Kamera- und Tontechnik werden in Kurzworkshops angeboten. Die im Kurs erarbeiteten filmischen Ergebnisse soll zum Abschluss öffentlich präsentiert werden. ---
- Betreuung Individuelles Mastervorhaben (erstes Semester) bei Florian Wüst (Vertretung für Beat Brogle) Der wesentliche Fokus im ersten Semester liegt auf der Ausformulierung und Weiterentwicklung des Mastervorhabens, auf Designforschungsfragen und der selbständigen Aneignung entsprechender Skills. Ausgehend vom Exposé aus der Aufnahmeprüfung, dem Portfolio und der BA-Abschlussarbeit werden in den Plena die individuellen Ansätze, Methoden und Instrumente für den weiteren Gestaltungsprozess vorgestellt, reflektiert und diskutiert. Spätestens nach den ersten sechs Wochen entscheiden sich die Studierenden für mindestens einen, in der Regel zwei Lehrende, die ihr Mastervorhaben studienbegleitend betreuen. Individuell werden Gesprächstermine direkt mit den Betreuerinnen und Betreuern für Austausch und Feedback abgestimmt. Im Vergleich zum Bachelor nimmt das Selbststudium im Masterstudium einen wesentlich höheren Anteil ein. In den Werkstätten vertiefen die Studierenden in Rücksprache mit den Werkstattleiter*innen und Lehrenden ihre handwerklichen Fähigkeiten und Fertigkeiten, experimentieren zu ihren Entwürfen und eignen sich in Hinblick auf ihr Mastervorhaben und ihre Profilbildung benötigte Skills und Softskills an. Die Lehre findet in Form von Plena und in Einzelgesprächen bzw. idealerweise auch in Form von Teamarbeit oder intensivem Austausch mit den Kommilitoninnen und Kommilitonen der HfK statt. --- Without a visual representation, it is difficult to imagine the structure of an atom. Similarly, the processes of photosynthesis are hard to grasp without an illustration or diagram. Even everyday tasks, such as assembling a piece of furniture, can quickly become challenging without a step-by-step visual guide. Visual representations of information, data, or knowledge that make complex ideas easily understandable appear across disciplines and contexts - from science to everyday life. Clearly, language is not the only medium for conveying knowledge and information. Design strategies such as infographics, illustrations, maps, models, and many others play a crucial role, and when it comes to simplifying, clarifying, and making complex relationships visible, they can even surpass language. The central thesis of this seminar is: Using design strategies, we can make content comprehensible that is often difficult to access through language alone. This potential is far from fully utilized. Together, we will explore and experiment with visual and design strategies both theoretically and practically, with the goal of making complex concepts more accessible. Accordingly, the central question of the course is: How can designers use visual strategies to overcome barriers to understanding and make complex content clear and accessible? The range of possible topics is broad: from everyday applications such as instruction manuals or step-by-step guides to scientific subjects, such as facts and myths about ADHD and autism, climate change, and more. Social science topics, including racism, diversity, inclusion, and social inequality, are also well suited for visually accessible presentations. Even abstract philosophical concepts and schools of thought can be made approachable through illustrations! Students are encouraged to engage theoretically with visual possibilities and strategies and then apply this knowledge in practice. For this purpose, you will choose a topic that aligns with your interests and develop a visual representation to make it comprehensible. The goal is to communicate the chosen topic in an innovative and visually effective way. Structure The seminar is organized in consecutive working phases, ranging from research, reading, and theoretical reflection to idea development. In a series of structured inputs, we will explore the fundamentals of information design, focusing on clarity, comprehensibility, and accessibility. Throughout the project, students will then work on their own independent projects on a self-chosen topic, developing innovative
- Betreuung Individuelles Mastervorhaben (zweites Semester) bei Florian Wüst (Vertretung für Beat Brogle) Der wesentliche Fokus im zweiten Semester liegt auf der Ausformulierung und Weiterentwicklung des Mastervorhabens, auf Designforschungsfragen und der selbständigen Aneignung entsprechender Skills. Ausgehend vom Exposé aus der Aufnahmeprüfung, dem Portfolio und der BA-Abschlussarbeit werden in den Plena die individuellen Ansätze, Methoden und Instrumente für den weiteren Gestaltungsprozess vorgestellt, reflektiert und diskutiert. Spätestens nach den ersten sechs Wochen entscheiden sich die Studierenden für mindestens einen, in der Regel zwei Lehrende, die ihr Mastervorhaben studienbegleitend betreuen. Individuell werden Gesprächstermine direkt mit den Betreuerinnen und Betreuern für Austausch und Feedback abgestimmt. Im Vergleich zum Bachelor nimmt das Selbststudium im Masterstudium einen wesentlich höheren Anteil ein. In den Werkstätten vertiefen die Studierenden in Rücksprache mit den Werkstattleiter*innen und Lehrenden ihre handwerklichen Fähigkeiten und Fertigkeiten, experimentieren zu ihren Entwürfen und eignen sich in Hinblick auf ihr Mastervorhaben und ihre Profilbildung benötigte Skills und Softskills an. Die Lehre findet in Form von Plena und in Einzelgesprächen bzw. idealerweise auch in Form von Teamarbeit oder intensivem Austausch mit den Kommilitoninnen und Kommilitonen der HfK statt. ---
- Integrierendes Projekt (zweites Semester) bei Florian Wüst (Vertretung für Beat Brogle) Einstellung zum Selbst 15. Oktober – 28. November 2025 Florian Wüst in Zusammenarbeit mit Daniel Neubacher (Videowerkstatt) „Die Einstellung ist die Einstellung. Die Einstellung von etwas und die Einstellung zu etwas.“ (Gertrud Koch) Die Einstellung ist ein kontinuierlich belichtetes, auf Video oder digital aufgezeichnetes, ungeschnittenes Stück Film. Bis die Kamera „rollt“, erfolgen zur Einrichtung der Einstellung unzählige Entscheidungen: ein Standpunkt wird bestimmt, eine Optik gewählt, Licht gesetzt, Akteur:innen platziert usw.. Spiel- und Dokumentarfilm unterscheiden sich hier nicht grundsätzlich. Die Konstruiertheit der dokumentierten Realität ist selbst der Aufnahme einer verwackelten Handykamera eingeschrieben. Die Frage nach der Wahrheit der Bilder ist längst irrelevant, wie Hito Steyerl in „Die Farbe der Wahrheit. Dokumentarismen im Kunstfeld“ (2008) in Bezug auf von CNN ausgestrahlte Bilder eines Korrespondenten im Irakkrieg darlegt, auf denen kaum etwas zu sehen ist: „Sie repräsentieren nichts, zumindest nichts Erkennbares mehr. Ihre Wahrheit liegt jedoch in ihrem Ausdruck. Sie sind lebhafter und akkurater Ausdruck jener Ungewissheit, die nicht nur die zeitgenössische dokumentarische Produktion beherrscht, sondern die Welt der Gegenwart schlechthin.“ Das verwackelte oder unscharfe Bild ist seit jeher Methode eines subjektiven Blicks, der sich über technische Unzulänglichkeit artikuliert und dem das Ungewisse zuspielt: Hier spricht das Ich der Filmemacher:in ohne Gewähr. Wenn das Dargestellte und die Darstellung ein Verhältnis eingehen, das die Gegebenheiten der Produktion nicht kaschiert, sondern offenlegt, geradezu ausstellt, übernimmt die Filmemacher:in sichtbar Verantwortung, macht sich angreifbar, umso mehr beim Tritt vor die Kamera und ans Mikrofon, dort, wo es kein Versteck hinter der vermeintlichen Objektivität eines dokumentarischen Bildes, einer neutralen Sprecher:innenstimme oder einer fiktiven Handlung gibt. Auch in diesem Sinne bildet die „Einstellung zu etwas“ den Kern der autobiografischen und autofiktionalen Erzählung im Film. Das Gestalterische Projekt mit Theorieanteil „Einstellung zum Selbst“ will dazu anleiten, dezidiert subjektive, autobiografische oder autofiktionale Ansätze zu entwickeln und mit Mitteln des Films umzusetzen – von performativer Selbstinszenierung, Reenactment, Alltagsdokumentation, Filmtagebuch und -essay bis zu Found Footage. Involviertheit, affektive Zeugenschaft oder auch die Beziehung von indviduellem und kollektivem Erinnern sollen im Vordergrund der Auseinandersetzung mit Themen stehen, denen eine persönlich empfundene Dringlichkeit unterliegt, seien es die neuen autoritären Tendenzen und Sprachverbote in der Gesellschaft oder die blinden Flecken der eigenen Familiengeschichte. Der siebenwöchige Kurs umfasst sowohl Praxisübungen als auch Theorieeinheiten in Form diskursiver Inputs und gemeinsamer Sichtungen von Filmen u.a. von Alex Gerbaulet, Maria Mayland, Valérie Mrejen und Silke Schönfeld. Diese unterstützen die Erlangung künstlerischer Entscheidungskompetenzen im komplexen Arbeitsbereich des bewegten Bildes. Einführungen in Schnittprogramme, Kamera- und Tontechnik werden in Kurzworkshops angeboten. Die im Kurs erarbeiteten filmischen Ergebnisse soll zum Abschluss öffentlich präsentiert werden. ---
- Integrierendes Projekt + Workshop bei Florian Wüst (Einstellung zum Selbst, Vertretung für Beat Brogle) Einstellung zum Selbst 15. Oktober – 28. November 2025 Florian Wüst in Zusammenarbeit mit Daniel Neubacher (Videowerkstatt) „Die Einstellung ist die Einstellung. Die Einstellung von etwas und die Einstellung zu etwas.“ (Gertrud Koch) Die Einstellung ist ein kontinuierlich belichtetes, auf Video oder digital aufgezeichnetes, ungeschnittenes Stück Film. Bis die Kamera „rollt“, erfolgen zur Einrichtung der Einstellung unzählige Entscheidungen: ein Standpunkt wird bestimmt, eine Optik gewählt, Licht gesetzt, Akteur:innen platziert usw.. Spiel- und Dokumentarfilm unterscheiden sich hier nicht grundsätzlich. Die Konstruiertheit der dokumentierten Realität ist selbst der Aufnahme einer verwackelten Handykamera eingeschrieben. Die Frage nach der Wahrheit der Bilder ist längst irrelevant, wie Hito Steyerl in „Die Farbe der Wahrheit. Dokumentarismen im Kunstfeld“ (2008) in Bezug auf von CNN ausgestrahlte Bilder eines Korrespondenten im Irakkrieg darlegt, auf denen kaum etwas zu sehen ist: „Sie repräsentieren nichts, zumindest nichts Erkennbares mehr. Ihre Wahrheit liegt jedoch in ihrem Ausdruck. Sie sind lebhafter und akkurater Ausdruck jener Ungewissheit, die nicht nur die zeitgenössische dokumentarische Produktion beherrscht, sondern die Welt der Gegenwart schlechthin.“ Das verwackelte oder unscharfe Bild ist seit jeher Methode eines subjektiven Blicks, der sich über technische Unzulänglichkeit artikuliert und dem das Ungewisse zuspielt: Hier spricht das Ich der Filmemacher:in ohne Gewähr. Wenn das Dargestellte und die Darstellung ein Verhältnis eingehen, das die Gegebenheiten der Produktion nicht kaschiert, sondern offenlegt, geradezu ausstellt, übernimmt die Filmemacher:in sichtbar Verantwortung, macht sich angreifbar, umso mehr beim Tritt vor die Kamera und ans Mikrofon, dort, wo es kein Versteck hinter der vermeintlichen Objektivität eines dokumentarischen Bildes, einer neutralen Sprecher:innenstimme oder einer fiktiven Handlung gibt. Auch in diesem Sinne bildet die „Einstellung zu etwas“ den Kern der autobiografischen und autofiktionalen Erzählung im Film. Das Gestalterische Projekt mit Theorieanteil „Einstellung zum Selbst“ will dazu anleiten, dezidiert subjektive, autobiografische oder autofiktionale Ansätze zu entwickeln und mit Mitteln des Films umzusetzen – von performativer Selbstinszenierung, Reenactment, Alltagsdokumentation, Filmtagebuch und -essay bis zu Found Footage. Involviertheit, affektive Zeugenschaft oder auch die Beziehung von indviduellem und kollektivem Erinnern sollen im Vordergrund der Auseinandersetzung mit Themen stehen, denen eine persönlich empfundene Dringlichkeit unterliegt, seien es die neuen autoritären Tendenzen und Sprachverbote in der Gesellschaft oder die blinden Flecken der eigenen Familiengeschichte. Der siebenwöchige Kurs umfasst sowohl Praxisübungen als auch Theorieeinheiten in Form diskursiver Inputs und gemeinsamer Sichtungen von Filmen u.a. von Alex Gerbaulet, Maria Mayland, Valérie Mrejen und Silke Schönfeld. Diese unterstützen die Erlangung künstlerischer Entscheidungskompetenzen im komplexen Arbeitsbereich des bewegten Bildes. Einführungen in Schnittprogramme, Kamera- und Tontechnik werden in Kurzworkshops angeboten. Die im Kurs erarbeiteten filmischen Ergebnisse soll zum Abschluss öffentlich präsentiert werden. ---
Veranstaltungen